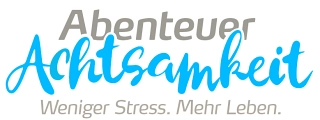Einführung in Achtsamkeit und Kraft
Die Integration von Achtsamkeit und Charakterstärken ist ein aufstrebendes Forschungsgebiet, das sich mit der Verbesserung des Wohlbefindens, der Stressbewältigung und der zwischenmenschlichen Beziehungen befasst. Diese Ansätze zielen darauf ab, das Beste im Menschen zu fördern und zu nutzen, um sowohl die Achtsamkeitspraxis als auch die Anwendung von Charakterstärken zu vertiefen.
Vorteile der Integration von Achtsamkeit und Charakterstärken
Verbesserung des Wohlbefindens und der Stressbewältigung: Studien zeigen, dass Programme wie die Mindfulness-Based Strengths Practice (MBSP) das Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren können. Diese Programme sind in einigen Fällen effektiver als traditionelle Achtsamkeitsprogramme, insbesondere in Bezug auf die Förderung positiver Beziehungen und die Bewältigung von Stress und Problemen (Whelan-Berry & Niemiec, 2021; Pang & Ruch, 2019).
Arbeitsbezogene Vorteile: Die Kombination von Achtsamkeit und Charakterstärken hat sich als vorteilhaft für die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsleistung erwiesen. Während Achtsamkeit allein das Wohlbefinden am Arbeitsplatz verbessert, steigert die zusätzliche Integration von Charakterstärken die Motivation und damit die Arbeitsleistung (Pang & Ruch, 2019).
Mechanismen der Wirkung
Starke Achtsamkeit: Die Integration von Charakterstärken in die Achtsamkeitspraxis, auch als „starke Achtsamkeit“ bezeichnet, hilft, Barrieren in der Achtsamkeitspraxis zu überwinden und das achtsame Leben in verschiedenen Alltagssituationen zu fördern, wie z.B. beim Gehen, Fahren oder Kommunizieren (Niemiec et al., 2012).
Neurobiologische Grundlagen: Obwohl die genauen neuronalen Mechanismen der Achtsamkeitspraxis noch nicht vollständig verstanden sind, zeigen neuroimaging-Studien, dass Achtsamkeit positive Effekte auf die physische und mentale Gesundheit sowie die kognitive Leistung hat (Tang et al., 2015).
Herausforderungen und zukünftige Forschungsrichtungen
Notwendigkeit methodisch rigoroser Studien: Trotz der positiven Ergebnisse gibt es einen Bedarf an methodisch strengeren Studien, um die neuronalen und molekularen Grundlagen der durch Achtsamkeit induzierten Veränderungen im Gehirn besser zu verstehen (Tang et al., 2015).
Erweiterung der theoretischen Grundlagen: Es besteht ein Bedarf an weiterer theoretischer Entwicklung und empirischer Forschung, um die Mechanismen zu klären, durch die Achtsamkeit ihre positiven Effekte entfaltet, und um die Integration von Achtsamkeit und Charakterstärken weiter zu erforschen (Brown et al., 2007).
Fazit
Die Kombination von Achtsamkeit und Charakterstärken bietet vielversprechende Ansätze zur Verbesserung des individuellen Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit, sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Kontext. Zukünftige Forschungen sollten sich auf die Vertiefung des Verständnisses der zugrunde liegenden Mechanismen und die Entwicklung methodisch rigoroser Studien konzentrieren, um die Wirksamkeit dieser Ansätze weiter zu validieren.
Studien zu Achtsamkeit und Kraft
Whelan-Berry, K., & Niemiec, R. (2021). Integrating Mindfulness and Character Strengths for Improved Well-Being, Stress, and Relationships: A Mixed-Methods Analysis of Mindfulness-Based Strengths Practice. International Journal of Wellbeing, 11, 38-50. https://doi.org/10.5502/IJW.V11I2.1545
Pang, D., & Ruch, W. (2019). Fusing Character Strengths and Mindfulness Interventions: Benefits for Job Satisfaction and Performance. Journal of Occupational Health Psychology, 24, 150–162. https://doi.org/10.1037/ocp0000144
Niemiec, R., Rashid, T., & Spinella, M. (2012). Strong Mindfulness: Integrating Mindfulness and Character Strengths. Journal of mental health counseling, 34, 240-253. https://doi.org/10.17744/MEHC.34.3.34P6328X2V204V21
Tang, Y., Hölzel, B., & Posner, M. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16, 213-225. https://doi.org/10.1038/nrn3916
Brown, K., Ryan, R., & Creswell, J. (2007). Mindfulness: Theoretical Foundations and Evidence for its Salutary Effects. Psychological Inquiry, 18, 211 – 237. https://doi.org/10.1080/10478400701598298